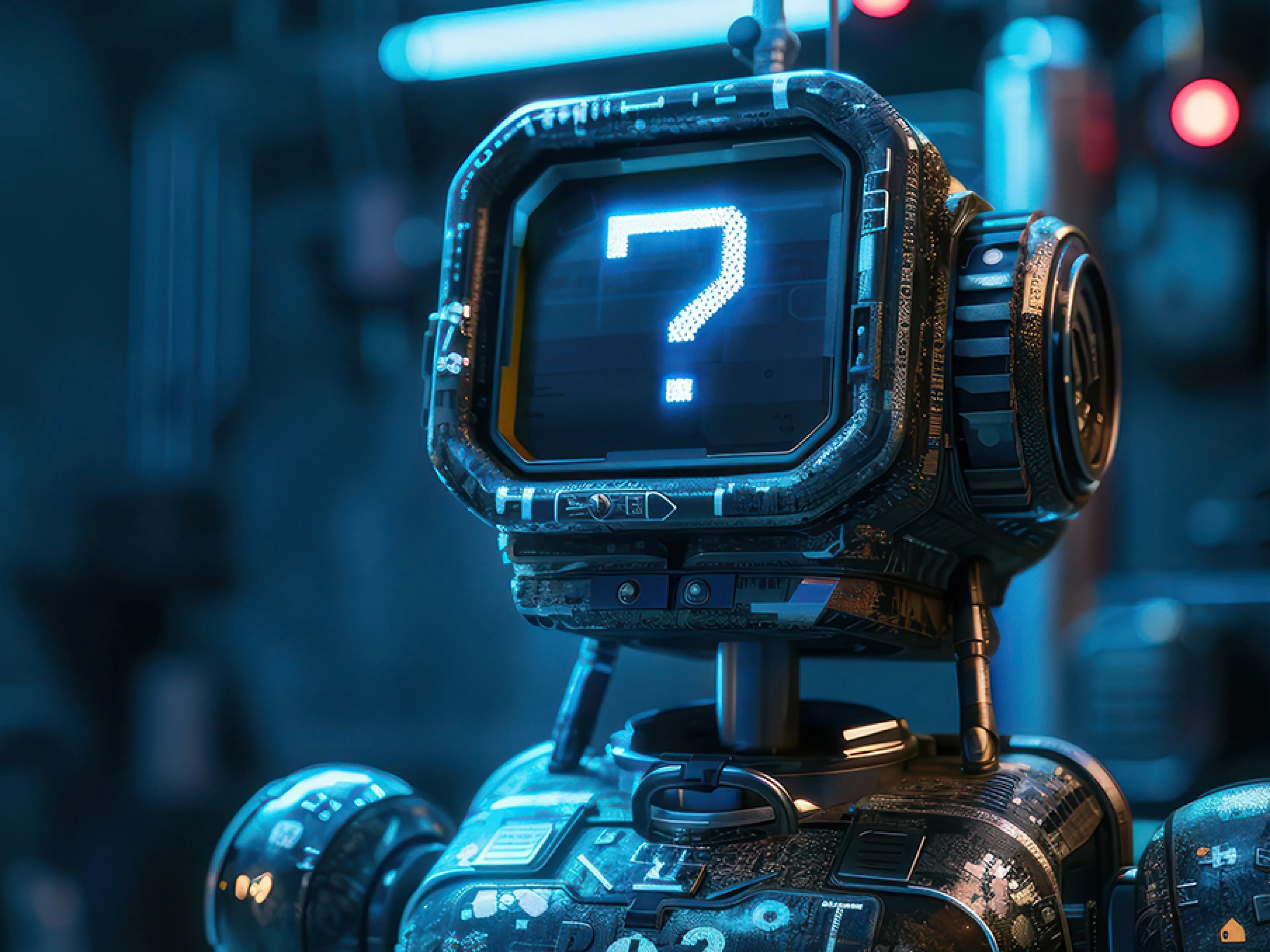Maschinen, deren Lebenszyklus digital abgebildet wird, von der Herstellung über den Betrieb bis zur Wiederverwertung. Was lange als Zukunftstechnologie galt, wird zunehmend zum industriellen Standard. Bei den ersten R. Stahl Digital Twin Days am 09. und 10. Oktober 2025 zeigten Fachleute aus Industrie, Forschung und Verbänden, wie digitale Zwillinge, Verwaltungsschalen und digitale Produktpässe (DPP) bereits heute in der industriellen Praxis Anwendung finden. Die Technologien ermöglichen eine höhere Transparenz, verbessern die Datenverfügbarkeit und schaffen die Grundlage für messbare Nachhaltigkeit und gezielte Prozessoptimierung in der Industrie 4.0.
Industrie 4.0 wird durch digitale Zwillinge greifbar
Im Rahmen der ersten R. Stahl Digital Twin Days diskutierten Fachleute aus Industrie, Wissenschaft und Verbänden über den konkreten Nutzen digitaler Produktpässe (DPP) und Verwaltungsschalen (AAS) in der vernetzten Produktion. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sich mit diesen Technologien Datenflüsse automatisieren und Nachhaltigkeitsziele umsetzen lassen, auch vor dem Hintergrund kommender EU-Vorgaben ab 2026. Anhand konkreter Anwendungsbeispiele und Live-Demonstrationen wurde deutlich: Digitale Zwillinge und standardisierte Datenmodelle sind bereits heute Bestandteil industrieller Prozesse und keine Zukunftsvision mehr.
Digitaler Produktpass als Basis für Industrie 4.0
„Der digitale Produktpass wird zu einer zentralen Technologie der Industrie 4.0, die Unternehmen Transparenz, Effizienz und Nachhaltigkeit ermöglicht“, betonte Dr. Stefan Schork vom ZVEI. Der DPP bündelt sämtliche Produktinformationen, von Herstellung, Materialeinsatz und Nutzung bis zu Reparaturfähigkeit und Recycling. Dies passiert in maschinenlesbarer Form und erlaubt so automatisierte Datenflüsse über verschiedene Systeme hinweg. Standardisierte Schnittstellen wie QR-Codes und Verwaltungsschalen erleichtern die Integration in bestehende Produktions- und Gebäudesysteme. Hier macht insbesondere die Möglichkeit, Nachhaltigkeitsleistungen transparent darzustellen, den DPP für Unternehmen unverzichtbar: „Wer seine Ressourcennutzung offenlegt, stärkt nicht nur das Vertrauen, sondern erschließt auch neue Geschäftsmodelle für Reparatur, Upgrades und nachhaltige Produktgestaltung.“
Digitale Zwillinge bringen Effizienz durch digitale Datenketten
Wie digitale Zwillinge in großen Industrieprojekten eingesetzt werden, zeigte Dr. Carl-Philipp Ding vom Digital Data Chain Consortium eindrucksvoll. Klassischerweise gehen bis zu 80 Prozent der relevanten Daten zwischen den Bereichen Asset Management, Montage, Instandhaltung und Engineering verloren. Mithilfe digitaler Zwillinge werden physische Objekte eindeutig mit ihren digitalen Informationen verbunden, wodurch alle Daten unabhängig von der Rolle des Nutzers effizient nutzbar werden. „Schon Teilimplementierungen bieten sofort Mehrwert“, so Ding. Die Harmonisierung von Standards wie VDI 2770 und der Asset Administration Shell ermöglicht den datenübergreifenden Austausch und die Interoperabilität zwischen Unternehmen.
Open-Source-Lösungen für einfache Umsetzung
Anschließend demonstrierte Frank Schnicke vom Fraunhofer IESE, wie Open-Source-Plattformen wie „BaSyx“ digitale Anwendungen und Verwaltungsschalen vereinfachen. Mithilfe der Plattform können Daten standardisiert erfasst, geprüft und geteilt werden, ohne dass tiefes technisches Wissen erforderlich ist. Mögliche Anwendungen reichen von Produktionsprozessen bis zur Überwachung kritischer Infrastrukturen. Schnicke hob hervor: „,Eclipse BaSyx‘ ist nicht nur eine technische Plattform, sondern eine Community-getriebene Initiative. Hier lernen Unternehmen von Best Practices und können Standards gemeinsam weiterentwickeln.“
Integration in Engineering-Prozesse
Effizienzsteigerung im Engineering war ein zentrales Thema. Constantin Liepert und Siegmund Broja, beide von Siemens Industry Software, erklärten, wie die AAS-Integration in den PLM-Software-Lösungen Teamcenter und Comos den manuellen Aufwand drastisch reduziert. Dadurch müssen Ingenieure Daten nicht mehr mühsam aus unterschiedlichen Quellen sammeln, sondern können sie zentral abrufen, prüfen und in Stücklisten integrieren. „Durch die Nutzung von AAS sparen Ingenieure bis zu 60 Prozent Zeit“, berichteten die Referenten.
Ebenfalls betonten Henry Bloch und Richard Zielinski von Aucotec die Vorteile einer kooperativen Plattform, die alle Phasen von der Planung über die Elektrotechnik und Steuerung bis zum Data Handover abbildet. Innerhalb der AAS sorgen standardisierte Submodelle für konsistente Datenstrukturen, ermöglichen die Rückverfolgbarkeit und erleichtern die Kundenintegration. Somit kann der Kunde den aktuellen Stand seines Projekts einsehen, ohne dass PDF- oder E-Mail-Ketten nötig sind.
Johannes Geyrhalter von Eplan fügte hinzu, dass verwaltete, standardisierte Datenflüsse die Grundlage für KI-Anwendungen bilden. Mithilfe von AAS können Produktionsbenachrichtigungen, End-of-Life-Erkennung und automatische Anpassungen in Projekten umgesetzt werden. „Ziel ist eine durchgängige digitale Wertschöpfungskette von der Komponentenauswahl bis zum Betrieb“, so Geyrhalter.
Digitale Zwillinge als Werkzeug für Planung und Betrieb
Prof. Dr. Michael Hoffmeister von der IDTA unterstrich die Bedeutung digitaler Zwillinge für Frontloading: Prozesse werden bereits in der Planungsphase simuliert, bevor physische Maschinen gebaut werden. So lassen sich Fehler frühzeitig erkennen und kostspielige Nacharbeiten vermeiden. Digitale Zwillinge werden als modulare Verwaltungsschalen umgesetzt, die Mechanik, Elektrik und Software abbilden und interoperabel zwischen Partnern nutzbar sind. „Die Technologien sind schon praktikabel einsetzbar und die Zukunft liegt darin, sie breiter zugänglich zu machen“, erklärte Hoffmeister.
Normung und Standardisierung treiben das Ökosystem
Laut Sebastian Schröder von der DKE sind Normen und digitale Produktpässe ein Booster für das gesamte Ökosystem. Durch die Integration regulatorischer Anforderungen wie Ökodesign oder dem Cyber Resilience Act in Verwaltungsschalen entsteht eine standardisierte, dezentrale Datenbasis. Die Vision ist ein interoperables System, das regulatorische, rechtliche und private Daten transparent macht.
Britta Waligora von Conplement zeigte praktische Erfahrungen: Durch Pilotprojekte mit kleinen Produktgruppen ist ein schrittweiser Einstieg möglich, der interne Ressourcen schont und erste Erfolge liefert. „Loslegen, klein starten, kontinuierlich erweitern und Partner einbinden“ sei der Schlüssel, um digitale Transformation greifbar zu machen.
Prozessindustrie: Digitale Zwillinge und Verwaltungsschalen sorgen für mehr Effizienz
Michael Riester von Endress + Hauser demonstrierte, wie digitale Zwillinge und Verwaltungsschalen die Prozessindustrie effizienter machen: Dadurch wird die Informationsverfügbarkeit erhöht, die Produktqualität verbessert und der Ressourceneinsatz optimiert. Arbeitsabläufe lassen sich durch den Abbau manueller Schnittstellen und Medienbrüche deutlich verschlanken. Wie Pilotprojekte bestätigen, bringt eine schrittweise Einführung direkt messbare Vorteile. „Mut zum Testen, eine Schritt-für-Schritt-Strategie und enge Zusammenarbeit aller Beteiligten sind entscheidend für den Erfolg der Digitalisierung“, betonte Riester.
Ronny Becker von der IGR demonstrierte, wie durch NOA und Verwaltungsschale Eigensicherheitsnachweise automatisiert werden. Sensorinformationen, Geräteseriennummern und Zertifikate fließen direkt in Anwendungen und werden sofort aktualisiert. Hier ergibt sich eine hohe Zeitersparnis und Risikominimierung für den Betrieb.
Digitale Zwillinge in komplexen Anlagen
Martin Mayer von Zeta zeigte, wie physikalische digitale Zwillinge für Reinraumprozesse oder Wartungsplanung genutzt werden. Durch Simulationen, 3D-Darstellung und standardisierte Bausteine können Betriebszustände vorausschauend geplant werden. Die Kombination aus Technik, Softwarelösungen und Training der Mitarbeiter ermöglicht effiziente, internationale Einsatzszenarien. Mayer betonte: „Technologie allein reicht nicht. Der Mensch muss sie anwenden können.“
Fazit: Silos aufbrechen, Daten teilen, Zukunft sichern
Die R. Stahl Digital Twin Days haben deutlich gemacht, dass Datenflüsse, Standardisierung und digitale Zwillinge die Zukunft von Industrie 4.0 bestimmen werden. Dafür müssen Silos aufgebrochen, Daten aktiv geteilt und Innovationsprojekte konsequent in die operative Umsetzung überführt werden. Dabei sind Geduld, Hartnäckigkeit und die Vernetzung mit Partnern entscheidend. Die Vielzahl an Praxisbeispielen zeigte, dass die Digitalisierung bereits heute greifbare Effekte auf die Bereiche Effizienz, Compliance und Nachhaltigkeit hat.
„Wer frühzeitig digitale Zwillinge implementiert, spart Zeit, Ressourcen und steigert die Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette“, fasst Roland Dunker, Head of Digital Services bei R. Stahl die Veranstaltung zusammen. Die Kombination aus technologischen Lösungen, offenen Standards und praxisnaher Umsetzung schafft die Basis für die Industrie 4.0.